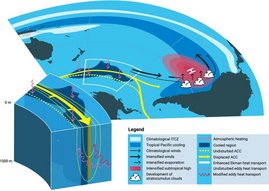Alle Lebewesen – ob wir sie schon kennen oder sie noch im Verborgenen leben – spielen eine wichtige Rolle für das Funktionieren von Ökosystemen und die Leistungen, die sie für uns erbringen. Insekten bestäuben Pflanzen und helfen, Schädlinge auf natürliche Weise in Schach zu halten. Pilze sind unverzichtbar für den Nährstoffkreislauf, bilden enge Partnerschaften mit zahlreichen Gefäßpflanzen und werden zudem in Industrie und Medizin vielfältig genutzt. Die Lebewesen im Boden bauen organisches Material ab und halten so den Nährstoffkreislauf in Gang, speichern Kohlenstoff, regulieren Wasser und liefern Nährstoffe für den Aufbau von Biomasse, die als Nahrung oder Energie genutzt werden kann. „Trotz all dieser und vieler weiterer bekannter Zusammenhänge wissen wir über die grundlegendste Frage der Biodiversität – wie viele Arten es tatsächlich auf der Erde gibt – noch immer viel zu wenig und haben keine verlässlichen Zahlen“, erklärt Erstautorin der neuen Studie Dr. Ricarda Lehmitz vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz und fährt fort: „Während der ‚Catalogue of Life‘ derzeit 2,3 Millionen rezente Arten auflistet, reichen die Schätzungen der globalen Artenvielfalt von fast 9 Millionen bis hin zu mehreren Milliarden Arten – wenn man berücksichtigt, dass der Großteil des Lebens aus mikrobiellen Arten besteht. Selbst in der Bundesrepublik Deutschland, einem Land mit langer Tradition naturkundlicher Forschung, ist unsere Wissenslücke enorm.“
Vor diesem Hintergrund haben sich acht deutsche Forschungseinrichtungen –das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB), das Naturkundemuseum Stuttgart, das Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), das Museum für Naturkunde in Berlin, das Naturkundemuseum Karlsruhe, die Zoologische Staatssammlung München und die Senckenberg Gesellschaft für Naturkunde – in der Initiative „Unbekanntes Deutschland“ zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, die bisher unbekannten Arten in Deutschland zu entdecken, zu beschreiben, besser zu verstehen, angepasste Schutzkonzepte zu entwickeln sowie die Öffentlichkeit für die namenlose Vielfalt zu sensibilisieren. Das Konsortium vereint Forschungsinstitute, naturkundliche Sammlungen, unabhängige Expert*innen sowie Museen mit Erfahrung in Wissenschaftskommunikation und -transfer. „Deutschland ist reich an naturkundlichem Wissen und Forschungsinfrastruktur, über 147 Millionen naturkundliche Sammlungsstücke werden in der Bundesrepublik aufbewahrt. Dieses enorme Erbe bietet eine ideale Ausgangsbasis, um zu zeigen, wie man die Vielfalt des Lebens gezielt und systematisch erfassen kann – durch die Kombination von Fachwissen, naturkundlichen Sammlungen, Citizen-Science-Projekten, modernen Technologien und Bildungsarbeit“, erläutert Prof. Dr. Bernhard Misof, LIB-Generaldirektor und Mitautor der Studie.
Laut Artenlisten und den Bewertungen der Roten Liste Deutschlands leben in Deutschland derzeit etwa 48.000 Tierarten, 9.500 Pflanzenarten und 16.000 Pilzarten. Doch diese Zahlen geben längst nicht die ganze Vielfalt in den 16 Bundesländern wieder, so das Forschungsteam. Während Wirbeltiere und Gefäßpflanzen relativ gut dokumentiert sind, gibt es große Wissenslücken bei Insekten und anderen wirbellosen Tieren, Pilzen, Bakterien sowie Ein- und Mehrzellern. Für diese existieren bisher weder vollständige Artenlisten noch Rote-Liste-Bewertungen. Wenn man das für gemäßigte Regionen übliche Verhältnis von Pilzen zu Pflanzen – 5:1 – anwendet, könnte Deutschland rund 48.000 Pilzarten beherbergen. Das bedeutet, dass aktuell etwa 65 Prozent dieser Pilze noch nicht dokumentiert wurden. Mithilfe von Metabarcoding-Daten aus 75 in ganz Deutschland aufgestellten Insektenfallen konnten Forschende 10.803 Insektenarten identifizieren. Gleichzeitig zeigte sich, dass weitere 21.043 Arten entweder noch keinen Referenzbarcode besitzen oder bislang unbeschrieben sind. „Regenwürmer, Käfer und Tausendfüßer sind recht gut bekannt, bei einigen Milbengruppen und Springschwänzen kennt man zwar die meisten Arten, weiß aber kaum etwas über ihre Bestandsentwicklungen und Funktionen. Bei anderen Milbengruppen oder auch bei den Fadenwürmern sind wir von vollständigen Artenlisten weit entfernt“, so Lehmitz und weiter: „Noch deutlicher wird die unbekannte Vielfalt, wenn man sogenannte ‚kryptische‘ Arten berücksichtigt, die äußerlich kaum zu unterscheiden sind.“
Auch über die Rollen dieser Arten im Ökosystem oder über ihre genetische Vielfalt sei viel zu wenig bekannt, heißt es in der Studie. In der Initiative „Unbekanntes Deutschland“ sollen daher alle Lebensformen – von Bakterien und Archaeen über Pilze, Protisten und Pflanzen bis hin zu kleinen und großen Tieren – in terrestrischen, Süßwasser- und Meeresökosystemen und auf allen Ebenen, von der molekularen Ebene bis hin zu ganzen Ökosystemen, untersucht werden. „Ein Beispiel zeigt, dass solch eine gezielte Forschungsarbeit wirkt: Die erfassten Süßwasser-Diatomeen in Deutschland stiegen in den letzten 20 Jahren durch intensive taxonomische Forschung um 46 Prozent, von 1.437 auf 2.103 Taxa“, so Lehmitz.
Mit herkömmlichen Methoden würde eine vollständige Erfassung der Biodiversität Deutschlands Jahrhunderte dauern, betont das Forschungsteam. Dank modernster Technologien wie Hochdurchsatz-Sequenzierung, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Datenintegration und Ökosystemmodellierung lassen sich diese Prozesse heute jedoch deutlich beschleunigen. Auch Citizen-Science-Projekte und Biodiversitätsdatenbanken spielen eine wichtige Rolle, indem sie Expert*innen bei der umfangreichen taxonomischen, ökologischen und naturschutzrelevanten Arbeit unterstützen.
„Mit der Initiative ‚Unbekanntes Deutschland‘ kombinieren wir moderne Ansätze mit fundierter taxonomischer Expertise und der Beteiligung der Öffentlichkeit, um in absehbarer Zeit eine umfassende Inventur der Biodiversität zu ermöglichen. Ich bin überzeugt, dass beispielsweise die Entdeckung neuer Spinnen- oder Ameisenarten in Deutschland das Interesse an biologischer Vielfalt weckt und in den Medien hohe Aufmerksamkeit findet“, gibt Senckenberg-Generaldirektor Prof. Dr. Klement Tockner, Letztautor der Studie, einen Ausblick und fährt fort: „Erste Schritte sind bereits getan: In einem gemeinsamen Workshop wurden bestehende Wissenslücken identifiziert, Finanzierungsmöglichkeiten geprüft und konkrete Projekte vorbereitet. Die Entdeckung, Beschreibung, funktionale Charakterisierung und Vermittlung der bislang unbekannten Biodiversität Deutschlands ist eine enorme, aber notwendige Aufgabe, wenn wir den unumkehrbaren Verlust biologischer Vielfalt aufhalten wollen.“
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Originalpublikation:
Lehmitz, R., Hohberg, K., Husemann, M. et al. Unknown Germany - An integrative biodiversity discovery program. npj biodivers 4, 41 (2025). https://doi.org/10.1038/s44185-025-00108-3