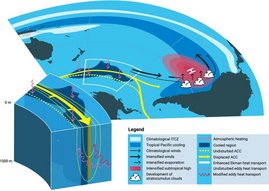Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die beschleunigten Veränderungsraten die Fähigkeit einiger Arten einschränken, ihren geeigneten Lebensraum eigenständig aufgrund ihrer natürlichen Ausbreitungsfähigkeit zu finden. Weitere Anstrengungen, Lebensräume besser zu vernetzen, Renaturierung zu fördern und Migration gezielt zu leiten, seien erforderlich, so die Autorinnen und Autoren. Dies gelte insbesondere für viele afrikanische Gebirge, in denen endemische Arten heimisch sind, die bereits in den höchsten Lagen vorkommen und daher keine weiteren Höhenlagen für eine Aufwärtsmigration zur Verfügung haben.
Das internationale Forscherteam unter der Führung von Prof. Dr. Christine Schmitt, Inhaberin des Lehrstuhls für Physische Geographie mit Schwerpunkt Mensch-Umwelt-Forschung an der Universität Passau, und ihrem ehemaligen Mitarbeiter Dr. João de Deus Vidal Jr., jetzt Universität Leipzig, entwickelte statistische Modelle, sogenannte Artverbreitungsmodelle, unter Berücksichtigung der Umweltpräferenzen der Pflanzenarten, ihrer Ausbreitungskapazität, der wahrscheinlichen Landnutzungsänderungen sowie der wahrscheinlichen Veränderungen der Klimavariablen bis zum Ende des Jahrhunderts. Insgesamt wurden die Modelle für 607 Gefäßpflanzenarten und drei vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) entwickelten Emissionsszenarien (SSPs) durchgeführt.
Die Prognosen deuten darauf hin, dass für fast die Hälfte der Pflanzenarten die geeigneten Lebensräume schrumpfen werden, selbst wenn die globale Erwärmung bis 2100 unter 2°C gehalten wird. Unter Hochemissionsszenarien werden sogar etwa drei Viertel der Pflanzenarten betroffen sein; Arten, die in höheren Lagen vorkommen, sogar noch mehr. Grundsätzlich kommen Bäume und Sträucher besser mit den neuen Voraussetzungen zurecht als Kräuter und Farne, für einige Baumarten jedoch wird prognostiziert, dass sie unter den Szenarien mit hohen Emissionen mehr als 90 Prozent ihres geeigneten Lebensraums verlieren und sich das Aussterberisiko entsprechend erhöht.
Für Pflanzenarten, die in höheren Lagen oder in geografisch isolierten Gebirgszügen vorkommen, ist die Lage besonders schwierig, da sie kaum Ausweichgebiete nach oben zur Verfügung haben. Die Studie zeigt, dass über alle Emissionsszenarien hinweg der Verlust an Artenreichtum in den Bergen in Madagaskar und im ostafrikanischen Hochland am höchsten ist, auch die südafrikanischen Gebirgszüge sind stark betroffen.
Der Fortbestand der vielfältigen Bergflora in Afrika hängt von Höhenverschiebungen und Ausdehnungen des Pflanzenverbreitungsgebiete ab, die allerdings nur dann stattfinden können, wenn Lebensräume vernetzt und biotische Wechselwirkungen wie Bestäubung und Ausbreitung gewährleistet sind; das Tempo der prognostizierten Arealverschiebungen wird bestimmt durch die Intensität des Klimawandels und von möglichen Landnutzungsänderungen.
Prof. Dr. Christine Schmitt: „Dies ist die erste umfassende Synthesestudie zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzenvielfalt in den Gebirgszügen Afrikas. Sie zeigt deutlich die Anfälligkeit dieser einzigartigen Ökosysteme, aber auch, dass die schlimmsten Auswirkungen auf die Pflanzenvielfalt in den afrikanischen Bergen noch abgewendet werden können, wenn die globale Erwärmung in Schach gehalten wird. Neben der Reduzierung der globalen CO2-Emissionen ist es entscheidend, die Landnutzungsänderung anzugehen, die häufig auch mit globalen Entwicklungen zusammenhängt. Eine Kultivierung außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes (ex-situ-Erhaltung) und Saatgutbanken wären praktikable Maßnahmen der letzten Instanz zum Schutz der am stärksten gefährdeten Arten.“
Dr. João de Deus Vidal Jr.: „Diese Studie ist das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit von 18 Forscherinnen und Forschern, die überwiegend an afrikanischen Institutionen tätig sind. Durch unsere Zusammenarbeit konnten wir einen kontinentalen Überblick über die Auswirkungen des Klimawandels auf die afrikanischen Gebirge erstellen, in den auch die Einschätzungen regionaler Expertinnen und Experten eingeflossen sind. Eine große Herausforderung besteht darin, die Beobachtung der Auswirkungen des Klimawandels über politische Grenzen hinweg zu ermöglichen und zu verbessern. Viele afrikanische Bergregionen erstrecken sich über mehrere Länder; durch die Zusammenarbeit mit mehreren lokalen Biodiversitätssammlungen wie etwa Herbarien kamen wir der Zusammenstellung eines Gesamtbildes näher.“
Über die Studie
Die Studie fasst 419.055 Verbreitungspunkte afrikanischer Pflanzenarten aus internationalen Datenbanken sowie veröffentlichten und unveröffentlichten Datenquellen zusammen. Darunter befinden sich 7.378 Arten, die in den afrikanischen Bergen endemisch sind, zu 607 von ihnen gibt es ausreichende botanische Datenaufzeichnungen. Die Studie kombiniert Klima-, Boden-, Topografie- und Landnutzungsdaten aus verschiedenen globalen Datensätzen und bezieht dabei Ausbreitungstypen, wie z. B. die Ausbreitung durch Wind und die ballistische Ausbreitung ein. So konnten die Modelle realistischer gestaltet werden, da ihre Ausbreitungskapazität die Fähigkeit einer Pflanzenart, geeignete Lebensräume zu erreichen, einschränken kann.
Universität Passau
Originalpublikation:
Vidal Junior, J. d. D., A. Antonelli, C. Carbutt, et al. 2025. “ Late 21st-Century Climate and Land Use Driven Loss of Plant Diversity in African Mountains.” Global Change Biology 31, no. 9: e70492. https://doi.org/10.1111/gcb.70492.