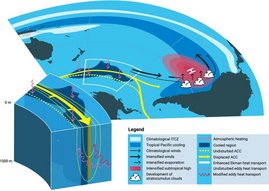Zentrale Ergebnisse „Bildung auf einen Blick 2025“
Der jährlich erscheinende OECD-Bericht „Education at a Glance“ hat das Ziel, anhand von quantitativen Indikatoren einen Vergleich der Bildungssysteme von 38 OECD-Staaten sowie weiteren Beitrittsländern und Partnerstaaten zu ermöglichen. Schwerpunktthema des diesjährigen Berichts ist die tertiäre Bildung.
Deutschland zeigt im internationalen Vergleich starke Ergebnisse bei beruflicher Bildung und Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen. 59 Prozent der 18- bis 24-Jährigen befinden sich in Ausbildung oder Studium, deutlich mehr als der OECD-Durchschnitt von 53 Prozent. Nur 10 Prozent sind weder in Bildung noch Beschäftigung, deutlich weniger als der OECD-Wert von 14 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt mit 2,7 Prozent ebenfalls unter dem OECD-Durchschnitt.
Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil an MINT-Abschlüssen: 35 Prozent der Hochschulabsolventinnen und -absolventen schließen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik ab – ein Spitzenwert weltweit. Zudem investiert Deutschland mit rund 19.500 US-Dollar pro Studierendem mehr als der OECD-Durchschnitt in die Hochschulbildung.
In den letzten fünf Jahren gab es positive Entwicklungen: Die Erwerbsquote von 25- bis 34-Jährigen ohne Sekundarabschluss stieg von 59 auf 61 Prozent, der Anteil mit Bachelor-Abschluss von 21 auf 23 Prozent. Weiterbildungsmaßnahmen werden zunehmend genutzt, besonders von Erwachsenen mit mittlerem Bildungsabschluss und hoher IT-Nutzung (54 Prozent gegenüber 49 Prozent OECD-Durchschnitt). Diese Trends zeigen die Wirksamkeit bildungspolitischer Maßnahmen für lebenslanges Lernen.
Trotz der Fortschritte bleiben Herausforderungen: Die Nichterwerbsquote bei geringqualifizierten Erwachsenen ist weiterhin hoch, und nach wie vor bestehen soziale Ungleichheiten beim Zugang zu frühkindlicher Bildung.
Politische Maßnahmen
Die Kultusministerkonferenz und der Bund setzen auf gezielte Programme wie „Schule macht stark“ und das Startchancen-Programm, um besonders benachteiligte Schulen zu unterstützen. Gegen den Lehrkräftemangel, vor allem in MINT-Fächern, fördern die Länder Quereinsteiger, nutzen außerschulische Lernorte und stärken digitale Bildungsangebote.
Im Hochschulbereich engagieren sich Bund und Länder gemeinsam für mehr Chancengerechtigkeit und Qualität. Das „Professorinnenprogramm“ fördert Gleichstellung und den Anteil von Frauen in Spitzenpositionen. Zudem unterstützen Maßnahmen wie das Tenure-Track-Programm die bessere Vereinbarkeit von Wissenschaftskarrieren und Familie. Mit dem 1.000-Köpfe-Plus-Programm bauen wir die internationale Attraktivität des deutschen Wissenschaftsstandortes weiter aus.
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär: „Es ist wichtig und ermutigend, dass die OECD-Studie zeigt: Deutschland ist ein hochqualifiziertes MINT-Land. In keinem anderen Land der Welt macht ein höherer Anteil der Absolventinnen und Absolventen im Tertiärbereich einen Abschluss in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Deutschland ist also MINT-Weltmeister! Das ist der große Standortvorteil Deutschlands. Dieses Potenzial gilt es, weiter zu heben – mit der Weiterentwicklung des MINT-Aktionsplans, mit MissionMINT sowie durch eine große BAföG-Reform, die die Reichweite der Förderung ausbaut und die Leistungen verbessert. Wir werden das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren, für verlässlichere Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir setzen mit dem 1.000-Köpfe-Plus Programm ein Zeichen für Wissenschaftsfreiheit und bauen die Attraktivität des Standortes Deutschland weiter aus. Und wir brauchen eine rasche und kraftvolle Umsetzung der Hightech-Agenda Deutschland, die wir vor wenigen Wochen im Kabinett beschlossen haben. Unser Ziel: Deutschland soll wieder an die Weltspitze in Schlüsseltechnologien. Neue Technologien sollen zum Markenzeichen Deutschlands werden. Durch mehr Investitionen in Zukunftstechnologien, durch bessere Rahmenbedingungen, durch Anreize, schneller von der Forschung in die Anwendung zu kommen. Die Hightech Agenda Deutschland hilft, sichere Arbeitsplätze zu schaffen, Abhängigkeiten zu reduzieren und den Alltag der Menschen zu verbessern.“
Parlamentarische Staatssekretärin im BMBFSFJ Mareike Wulf: „Deutschland steht im internationalen Vergleich besonders gut da, wenn es um berufliche Bildung und die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen geht. Doch die Studie zeigt auch: Wir haben noch zu viele geringqualifizierte Menschen und Defizite bei den Grundkompetenzen. Die vielen jungen Menschen ohne beruflichen Abschluss sind ein Risiko, sowohl für die ökonomische Leistungsfähigkeit unseres Landes als auch für den sozialen Zusammenhalt. Wir werden nachqualifizierende Wege zu einem Berufsabschluss ausbauen und bekannter machen – mit der Standardisierung und dem Ausbau von Teilqualifikationen. Wir werden die Übergänge von Schule in die Ausbildung weiter stärken und die berufliche Bildung insgesamt zukunftsfest gestalten. Zum Beispiel mit der geplanten Fortführung der Initiative Bildungsketten und mit dem Ausbau des Berufsorientierungsprogramms. Eine solide Ausbildung bleibt der Schlüssel für gute Perspektiven – beruflich und persönlich. Unser Ziel ist ein Bildungssystem, in dem Bund, Länder und Kommunen so gut zusammenarbeiten, dass das System faire Chancen bietet – von der Kita über die Schule bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter. Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, allen Menschen in Deutschland eine gute Perspektive als künftige Fachkraft zu schaffen! Das sollte unser gemeinsamer Anspruch sein.“
Präsidentin der Wissenschaftsministerkonferenz Bettina Martin: „Die Ergebnisse der diesjährigen OECD-Studie zeigen, dass sich die Anstrengungen von Bund und Ländern der vergangenen Jahre gelohnt haben. Sie haben aber neben dem Licht auch noch einige Schatten. So ist es gelungen, den Anteil der jungen Erwachsenen mit einem Hochschul- oder Meisterabschluss (tertiär) von 33 auf 40 Prozent stark zu erhöhen. Das ist eine gute Entwicklung, denn wir brauchen zunehmend hochqualifizierte Fachkräfte in Deutschland – gerade auch im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich, wo der Anteil derer mit einem Abschluss in Fächern international am höchsten ausfällt. Auch sind die deutschen Hochschulen in den vergangenen zehn Jahren für ausländische Studierende immer attraktiver geworden. Ihre Anzahl hat sich mehr als verdoppelt. Diese positive Entwicklung werden wir Länder gemeinsam mit dem Bund mithilfe der Internationalisierungsstrategie der KMK weiter vorantreiben. Damit der Hochschulstandort Deutschland auch zukünftig attraktiv bleibt, muss u.a. massiv in die Infrastruktur investiert werden. Ich begrüße daher sehr, dass die Bundesregierung eine Schnellbauinitiative im Hochschulbau angekündigt hat. Denn wir brauchen eine Infrastruktur, die auf dem neuesten Stand ist, vom Labor über den Hörsaal bis zur Mensa.“
Katharina Günther-Wünsch, Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, äußert sich als Vertreterin der Bildungsministerkonferenz: „Die OECD-Studie zeigt: Deutschland verfügt über starke Säulen – unsere duale Ausbildung eröffnet jungen Menschen Perspektiven, die frühkindliche Bildung erreicht immer mehr Kinder, und unsere Hochschulen ziehen internationale Talente an. Gleichzeitig macht der Bericht deutlich, wo wir handeln müssen: Chancengerechtigkeit stärken, Abschlüsse sichern und dem Lehrkräftemangel entschlossen begegnen, gerade in den MINT-Fächern. Noch immer verlassen zu viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss, und die Herkunft prägt den Bildungserfolg nach wie vor zu stark. Deshalb investieren die Länder gezielt in Sprachförderung, Ganztagsangebote und moderne Wege der Lehrkräftegewinnung. Zugleich bauen wir die berufliche Bildung weiter aus, damit sie auch künftig eine verlässliche Brücke in Beschäftigung und Studium schlägt. Unser Ziel ist klar: Ein starkes Bildungssystem, das Leistung fördert, Qualität sichert und die Fachkräfte hervorbringt, die Deutschland für seine Zukunft braucht.“
BMFTR
Zur Ländernotiz Deutschland: www.oecd.org/bildung-auf-einen-blick-2025
Zur Studie: Education at Glance Bildung auf einen Blick