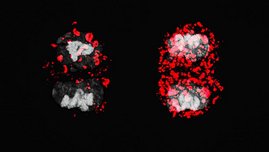„Wir wollten wissen, ob die Geschlechtsunterschiede in der Gehirngröße die Geschlechtsunterschiede in der Funktion des Gehirns erklären. Anders gesagt, ob Unterschiede in der Struktur des Gehirns eine Rolle für Unterschiede in der Ausbreitung des Funktionssignals spielen“, erklärt Bianca Serio den Aufbau ihrer Studie und betont weiter: „Einige Punkte sind jedoch wichtig zu beachten: Erstens, das durch fMRT gemessene Hirnfunktionssignal spiegelt in erster Linie physiologische und metabolische Mechanismen wider, nämlich durch regionale Veränderungen des Blutflusses. Es wäre daher falsch, automatisch davon auszugehen, dass Geschlechtsunterschiede im funktionellen Gehirnsignal Unterschiede in der Kognition oder im Verhalten erklären, und nicht nur physiologische und metabolische Unterschiede. Zweitens, Geschlechtsunterschiede in der Struktur und Funktion des Gehirns sind generell eher klein - es kann für einige Gehirnmerkmale zum Beispiel größere Unterschiede innerhalb einer Geschlechtergruppe geben als zwischen den einzelnen Geschlechtern. Einzelne Gehirne haben allgemeine Prinzipien der funktionellen Organisation gemeinsam, weisen aber ein gewisses Maß an Variabilität und Individualität auf. Wir haben also das Merkmal des biologischen Geschlechts verwendet und unsere Studienteilnehmer*innen in Kategorien unterteilt, um eine statistische Analyse durchzuführen und zu erforschen, ob Unterschiede in der grundsätzlichen funktionnellen Gestaltung des Gehirns teils mit den Unterschieden in strukturellen Merkmalen des Gehirns erklärt werden können.“
Die Forscherinnen haben für ihre Analyse Datensätze des Human Connectome Project genutzt, welches öffentlich zugänglich die Gehirn-Daten von 1000 Studienteilnehmer*innen enthält. „Entgegen unseren Erwartungen konnten wir herausfinden, dass Unterschiede in der Gehirngröße, -mikrostruktur und Abstand der funktionellen Verbindungen entlang der kortikalen Oberfläche die funktionellen Unterschiede zwischen den biologischen Geschlechtern nicht widerspiegeln können. Wir haben uns deswegen weiter angeschaut, welche Merkmale der Funktion der grundsätzlichen funktionellen Gestaltung des Gehirns erklären könnten. Hier haben wir festgestellt, dass es kleine Geschlechtsunterschiede in den Verbindungen innerhalb und zwischen funktionellen Netzwerken gibt, was die kleinen Unterschiede in der funktionale Netzwerktopographie zwischen den Geschlechtern allgemein erklären könnte. Die Unterschiede sind klein, aber kleine Effekte können manchmal teilweise helfen, bedeutsame Unterschiede in Mechanismen zu erklären. Da wir kognitive und verhaltensbezogene Assoziationen im Rahmen unserer Studie nicht geprüft haben, sollten wir dennoch vorsichtig sein, Spekulationen darüber anzustellen, was diese Unterschiede im Gehirn für beobachtbare Unterschiede zwischen den Geschlechtern bedeuten könnten. Eine Frage, die mich aber persönlich fasziniert, ist zum Beispiel warum Frauen statistisch gesehen zweimal mehr anfällig für Depressionen sind als Männer. Hierbei spielen zum Beispiel die Sexualhormone vermutlich eine bedeutsame Rolle, was sich wiederum eine Kollegin aus unserem Team genauer angeschaut hat.“, so Serio weiter. „Ich hoffe, dass unsere Grundlagenforschung zu allgemeinen Prinzipien der Gehirnorganisation uns ein paar Schritte weiterbringen kann, um solche bedeutsamen Themen grundsätzlich besser verstehen zu können.“
Dass dies dringend nötig ist, findet auch Svenja Küchenhoff, auf deren Studie sich Bianca Serio bezieht. „Wir haben leider immer noch eine ‚Female Data Gap‘ – auch in den Neurowissenschaften. Der männliche Körper wird als Standard angesehen und viele medizinische Lösungen passen daher nicht für viele Frauen. Um zu verstehen, was wirklich hinter medizinischen Problemen steckt, die Männer oder Frauen stärker betreffen, ist es wichtig, die darunterliegenden Faktoren zu betrachten - wie zum Beispiel Variation im Hormonspiegel.“ Deshalb hat sie in einer ebenfalls gerade in Nature Communications erschienene Studie gemeinsam mit Sofie Valk untersucht, inwieweit Sexualhormone die Gehirnstruktur beeinflussen. Sexualhormonrezeptoren sind sowohl in Neuronen als auch in Gliazellen weit verbreitet, was es ihnen ermöglicht, über verschiedene molekulare Mechanismen mit den wichtigsten Zellgruppen des Gehirns zu interagieren. Diese Mechanismen führten zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Gehirnstruktur sowie zu hormonbedingter Plastizität im Gehirn – sowohl durch körpereigene und künstliche Sexhormone, wie Svenja Küchenhoff beschreibt. „Wir haben uns die regionalen Unterschiede in der Mikrostruktur der Gehirnrinde, des Kortex, angeschaut und zwar mithilfe von Magnetresonanztomographie bei über 1000 gesunden Frauen und Männern. In einem ersten Schritt haben wir in der Studie gezeigt, dass es geschlechtsspezifische regionale Unterschiede in der Mikrostruktur der Gehirnrinde und des Hippocampus gibt. Allerdings verändern sich diese geschlechtsspezifischen Unterschiede, je nachdem, welches Hormonprofil man bei den Frauen betrachtet - teilweise verschwinden sie sogar ganz oder drehen sich um. Außerdem finden wir diese Effekte vor allem in Hirnregionen, in denen Gene von Östrogenrezeptoren und der Synthese von Sexualsteroiden besonders stark ausgeprägt werden. Zusammengenommen können wir also sagen, dass Sexualhormone eine wichtige Rolle in der Modulierung und Plastizität der Mikrostruktur des Gehirns haben.“
Beide Forscherinnen betonen, dass auch das biologische Geschlecht nicht binär ist: die Interaktion aus Chromosomen, Hormonen und Geschlechtsorganen ergibt ein Geschlechtskontinuum. Aus ihrer Sicht ist mehr Forschung erforderlich, um die Ursache von beobachtbaren Geschlechtsunterschieden im Gehirn sowie seine Bedeutung für Unterschiede in der Gesundheit und in der Kognition zu untersuchen.
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
Originalpublikationen:
Serio, B., Hettwer, M.D., Wiersch, L. et al. Sex differences in functional cortical organization reflect differences in network topology rather than cortical morphometry. Nat Commun15, 7714 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-51942-1
Küchenhoff, S., Bayrak, Ş., Zsido, R.G. et al. Relating sex-bias in human cortical and hippocampal microstructure to sex hormones. Nat Commun15, 7279 (2024). doi.org/10.1038/s41467-024-51459-7