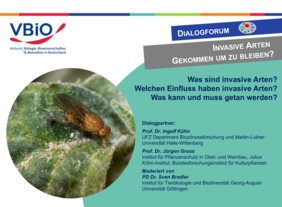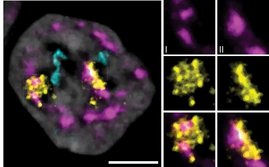Aufgrund des Klimawandels und der hohen Reiseaktivitäten der Menschen breiten sich viele nicht-heimische Pflanzen, Tiere und Pilze zum Teil massiv aus. Aber was ist überhaupt eine invasive Art im Vergleich zu einer gebietsfremden? Welchen Einfluss haben invasive Arten auf das Ökosystem oder den Menschen und sein Wohlergehen? Ist ihr Einfluss immer negativ oder gibt es auch positive Effekte? Welche Schäden verursachen Massenausbreitungen in der Landwirtschaft und welche Gegenmaßnahmen lassen sich ggf. treffen?
Diesen und weiteren Fragen widmete sich das Dialogforum zunächst mit zwei jeweils 20-minütigen Impulsvorträgen.
Der Pflanzenökologe Ingolf Kühn vom Umweltforschungszentrum in Halle beschrieb in seinem Impulsvortrag zunächst die Bedeutung der Begriffe Neobiota versus invasive Arten. Er beschrieb dabei auch, welche Barrieren während des Invasionsprozesses, d. h. der Einführung, Einbürgerung und Ausbreitung von gebietsfremden Arten überwunden werden müssen. Bei den Pflanzen wandern derzeit vor allem Arten aus wärmeren Gegenden ein, die eher Trockenheit ertragen und wärmeangepasst sind. Darüber hinaus gelangen gebietsfremde Pflanzen (aber auch Tiere, Pilze und Mikroorganismen) willentlich oder unwillentlich in natürliche Habitate.
Der chemische Ökologe Jürgen Gross vom Julius-Kühn-Institut in Dossenheim beleuchtete unter anderem die Ausbreitungsdynamik unterschiedlicher invasiver Arten. Denn oft kommen Neobiotia bereits früh an, werden aber erst Jahre später invasiv. So wurde die grüne Reiswanze bereits 1979 in Deutschland nachgewiesen – breitete sich aber erst nach 2015 invasiv aus und verursacht mittlerweile massive Schäden im Gemüse- und Obstbau. Andere gebietsfremde Arten breiten sich sofort massiv aus, wie das eigentlich aus Amerika stammende Feuerbakterium, das durch eine Schaumzikade übertragen wird und in Südeuropa zum Absterben von Oliven- oder Mandelbäumen führt. Die Kosten, die invasive Schaderreger verursachen, sind nicht einfach zu ermitteln. Sie werden für die EU mit jährlich 26 Mrd. Euro berechnet. Weltweit kommen in US$ 432 Mrd. zusammen.
Unter der Moderation von VBIO-Präsidiumsmitglied Sven Bradler diskutierten Ingolf Kühn und Jürgen Gross anschließend sehr intensiv und bezogen dabei auch die vielen Fragen aus dem Publikum ein. Dabei ging es um Informationen über einzelne invasive Arten wie z. B. das drüsige Springkraut, die kanadische Goldrute, den Riesenbärenklau oder die Schilfglasflügelzikade und den Waschbären. Etwa jede zehnte gebietsfremde Art ist invasiv. Die Geschwindigkeit der Verbringung neuer Arten hat sich deutlich beschleunigt – auch weil die Anzahl der verbrachten Individuen heute oft sehr hoch ist.
In Bezug auf die Fragestellung „Gekommen um zu bleiben?“ waren sich die Diskussionsteilnehmer einig, dass Neobiota in der überwiegenden Mehrheit bleiben werden. Das gilt zum Beispiel auch für die kanadische Goldrute. Allerdings betonten die Diskussionsteilnehmer, dass dies nicht gleichbedeutend damit sei, sich gar nicht um die Art zu kümmern. Gerade im Umfeld von Naturschutzgebieten sei ein Monitoring – und ggf. auch ein vorbeugendes Ausgraben - der Art sehr sinnvoll.
Umgekehrt wurde in diesem Dialogforum auch deutlich, dass Neobiota nicht immer negative Auswirkungen haben, sondern auch helfen können, ein Ökosystem an neue Gegebenheiten anzupassen, wie sie beispielsweise durch den Klimawandel entstehen.
Vor diesem Hintergrund gibt es eine ganze Reihe offener Fragen, die der wissenschaftlichen Untersuchung harren. Biowissenschaftliche Disziplinen wie Molekularbiologie, Physiologie, Biotechnologie und organismischer Biologie bis hin zur Ökologie leisten dabei ihren Beitrag – auch das wurde deutlich.
Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren hoch zufrieden und lobten insbesondere die Kompetenz der beiden Experten, die informative und sachliche Präsentationen sowie die lockere und sehr lebendige Diskussion.
(VBIO/Felicitas Pfeifer)