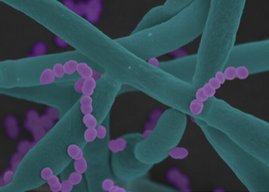Wirbeltiere besitzen extrem unterschiedlich große Gehirne: Bei gleicher Körpergröße kann die Gehirngröße um das Hundertfache variieren. In der Regel haben Säugetiere und Vögel auf ihre Körpergröße bezogen die größten Gehirne, gefolgt von Haien und Reptilien. Amphibien sowie die meisten Fische besitzen dagegen die kleinsten Gehirne aller Wirbeltiere.
Warum ist das so? In manchen Tiergruppen besitzen in Gruppen lebende Arten größere Gehirne als Einzelgänger. Sie müssen sich in schnell ändernden sozialen Situationen zurechtkommen und benötigen dafür ein leistungsfähigeres Gehirn. Hinzu kommt, dass Säugetiere und Vögel, die selbst Körperwärme erzeugen und deshalb eine höhere und auch stabilere Körpertemperatur haben, größere Gehirne besitzen als die meisten anderen Wirbeltiere, deren Körpertemperatur von der Umgebungstemperatur bestimmt wird. Aber warum das so ist, ist bislang unklar. Und außerdem gibt es auch innerhalb dieser Gruppen noch große Unterschiede.
Gehirngewebe benötigt gleichbleibend viel Energie. Anders als andere Organe lässt sich das Gehirn im Schlaf oder in Hungerphasen nicht einfach herunterfahren. Wenn also das Gehirn größer wird, muss der Organismus die Energie finden, um es zu versorgen. Der „Expensive Brain Hypothesis” zufolge kann das Gehirn nur dann wachsen, wenn es die zusätzliche Energie selbst produziert oder wenn es die Überlebenschancen des Organismus so stark verbessert, dass dieser es sich leisten kann, langsamer zu wachsen und sich zu vermehren. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise erklären, warum Affenarten, die im Jahresverlauf keine Hungerperioden und damit Energieeinbußen erdulden müssen, größere Gehirne besitzen und warum die Gehirne sesshafter Vögel größer sind als die von Zugvögeln.
Forschende des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz haben untersucht, ob diese Zusammenhänge für alle Wirbeltiere gelten. Sie haben herausgefunden, dass in allen Wirbeltiergruppen die Körpertemperatur einen wesentlichen Einfluss auf die Gehirngröße hat. Arten, die ihren Körper konstant warm halten, können sich in der Regel größere Gehirne leisten, da diese in warmer Umgebung leistungsfähiger sind. Das gilt nicht nur für sogenannte warmblütige, sondern auch für kaltblütige Arten, die in wärmeren Bedingungen leben oder diese gezielt wählen. Außerdem begrenzt den Forschenden zufolge auch die Größe der Nachkommen die Gehirngröße im Erwachsenenalter. Da die Kosten eines im Verhältnis zum Gewicht großen Gehirns für Jungtiere besonders hoch sind, zahlt es sich aus, den Wert erstmal niedrig zu halten. Die Gruppen, die es schaffen sowohl warme Körper zu haben als große Jungtiere zu produzieren, haben die größten Gehirne.
„Wir Menschen hatten also das Glück, Warmblütler zu sein und zudem sehr große Babys gebären zu können. Dadurch könnte sich das im Verhältnis zum Gewicht größte Gehirn aller Wirbeltiere entwickeln“, sagt Carel van Schaik, Leiter einer Fellowgruppe am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.
Eine konstant hohe Körpertemperatur war also die Voraussetzung dafür, dass die Evolution größere Gehirne hervorbringen konnte. Entstanden ist dieses Fähigkeit ursprünglich jedoch aus anderen Gründen – vermutlich, damit Säugetiere nachts aktiv bleiben und Vögel längere Strecken fliegen können. Erst danach stand die Tür für das Gehirnwachstum offen. In der Evolution können Neuerungen folglich ungeahnte Folgen haben und völlig neue Möglichkeiten eröffnen.
Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie
Originalpublikation:
Z. Song, M. Griesser & C.P. van Schaik: Parental investment and body temperature explain encephalization in vertebrates, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (45) e2506145122, https://doi.org/10.1073/pnas.2506145122 (2025).