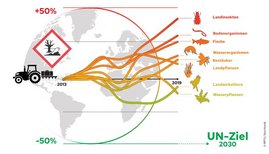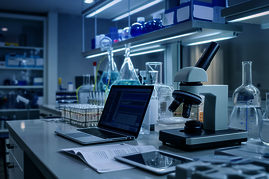Lange Zeit galt: Wenn wir beim Üben neuer Bewegungsabläufe eine Pause einlegen, wiederholt das Gehirn diese Bewegungen automatisch und festigt sie so. Eine neue Studie von Anwesha Das, Max-Philipp Stenner und Elena Azañón zeigt nun: Das stimmt so nicht. Pausen helfen uns, weil wir uns erholen und die nächste Bewegung planen können. Aber das eigentliche Lernen passiert in der aktiven Übung.
In fünf Experimenten trainierten Menschen Abfolgen von Fingerbewegungen. Eine Gruppe übte mit Pausen, die andere ohne. Während des Trainings schnitt die Pausen-Gruppe zunächst besser ab. Am Ende waren jedoch beide Gruppen gleich gut. Der Vorteil der Pausen hielt also nicht an.
„Kurze Pausen sind wertvoll. Sie geben Energie zurück und schaffen Raum, die nächsten Schritte zu planen. Aber sie beschleunigen nicht den Lernprozess“, zieht Max-Philipp Stenner Resümee.
Besonders deutlich zeigte sich das, wenn die Teilnehmenden immer wieder neue Bewegungsabfolgen üben mussten. Auch dann verbesserten sie sich nach jeder Pause kurzfristig – obwohl sie die Bewegungen gar nicht wiederholen konnten.
„Die Idee, dass unser Gehirn in Pausen einfach weiterlernt, klingt attraktiv – aber tatsächlich nutzt es die Zeit vor allem, um sich zu erholen und vorzubereiten. Dadurch entsteht die kurzfristige Leistungssteigerung“, erklärt Elena Azañón.
Noch klarer wurde das, als die Teilnehmenden die nächste Bewegung nach der Pause nicht im Voraus planen konnten: Dann fiel die Verbesserung deutlich geringer aus als bei der Vergleichsgruppe mit Planungssicherheit. Pausen helfen also vor allem dann, wenn sie Zeit zum Vorausdenken geben.
Die Ergebnisse sind wichtig für Schule, Musikunterricht oder Sport. Wer lernt, soll Pausen machen. Aber keine Wunder davon erwarten. Für die Medizin eröffnen die wissenschaftlichen Ergebnisse neue Perspektiven: Menschen mit Parkinson-Krankheit oder Gedächtnisstörungen zeigen veränderte Auswirkungen kurzer Pausen. Studien, die bislang im Sinne automatischer Lernprozesse interpretiert wurden, müssen jetzt neu bewertet werden.
(Leibniz-Institut für Neurobiologie)
Originalpublikation:
https://doi.org/10.1073/pnas.2509233122