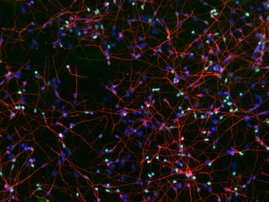Es gilt als unerschütterliches Lehrbuchwissen: Alle Pflanzen besitzen kleine Zellorganellen namens Plastiden – dazu gehören auch die Chloroplasten, die für die Photosynthese zuständig sind. Laut der sogenannten Endosymbiontentheorie entstanden diese Plastiden vor über einer Milliarde Jahren, als eine Urzelle ein photosynthetisches Bakterium aufnahm, es aber nicht verdaut, sondern in eine Art „Mitbewohner“ verwandelte, der fortan Energie produzierte. „Doch – wie so oft in der Natur – gibt es Ausnahmen: Die Sommerwurzen (Orobanchen) beispielsweise oder auch die Gattung Cuscuta aus der Familie der Windengewächse haben die Fähigkeit zur Photosynthese komplett aufgegeben und leben als clevere Parasiten. Solche Holoparasiten zapfen andere Pflanzen an, um an Nährstoffe zu kommen, anstatt selbst Energie zu erzeugen“, erklärt Prof. Dr. Stefan Wanke vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt und der Goethe-Universität Frankfurt. Sein Kollege und Erstautor der Studie Dr. Matthias Jost ergänzt: „Mit modernen DNA-Sequenzierungsmethoden wurde in den letzten Jahren entdeckt, dass manche dieser Holoparasiten ihren Reduktionsprozess sogar noch weitergetrieben haben – bis hin zum vollständigen Verlust des Plastiden-Genoms. Das war bislang bei zwei Gruppen bekannt: bei den Rafflesiaceae, zu denen die spektakuläre Titanenwurz (Rafflesia arnoldii) gehört, und bei der Grünalge Polytomella.“
Jost und Wanke haben nun gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam erstmalig nachgewiesen, dass es eine zweite Pflanzenfamilie innerhalb der Blütenpflanzen gibt – die Mystropetalaceae –, deren Plastidengenom vollständig verloren gegangen ist. Diese Familie umfasst die drei Gattungen Dactylanthus, Hachettea und Mystropetalon, die jeweils endemisch in Neuseeland, Neukaledonien und Südafrika vorkommen. Alle drei sind holoparasitische Pflanzen, also gänzlich von einer Wirtspflanze abhängig. „Dies ist erst der zweite bekannte Fall eines vollständigen Verlusts des Plastiden-Genoms bei höheren Pflanzen. Unsere Ergebnisse zeigen außerdem, dass der Verlust des Plastiden-Genoms in der Familie Mystropetalaceae nicht erst kürzlich passiert ist, sondern bereits beim gemeinsamen Vorfahren der gesamten Familie“, so Wanke. Dieser Ahn trennte sich wohl schon vor etwa 80 bis 100 Millionen Jahren von den photosynthetischen Pflanzen – also in einer Zeit, als viele heutige Blütenpflanzenfamilien erstmals in den Fossilfunden auftauchen, heißt es in der Studie.
Die Genomanalyse zeigt, dass nicht nur das Plastom fehlt, sondern auch viele Gene im Zellkern, die normalerweise Plastid-Proteine herstellen, verloren gegangen sind. Bei photosynthetischen Pflanzen sind rund zehn Prozent aller Gene im Zellkern mit Funktionen in den Plastiden verknüpft – bei Mystropetalaceae fehlen viele davon, insbesondere jene, die für die Genablesung und Proteinsynthese in den Plastiden nötig wären. Das stützt die Annahme der Forscher*innen, dass diese Gene im Laufe der Evolution verschwinden konnten, nachdem das Plastom selbst funktionslos geworden war.
Die neuen Erkenntnisse stellen grundlegende Annahmen der Pflanzenbiologie infrage. Lange galt das Plastiden-Genom als unverzichtbar für das Überleben einer Pflanzenzelle. Nun zeigt sich, dass selbst die nicht-photosynthetischen Funktionen der Plastiden vollständig auf den Zellkern übertragen oder sogar durch vom Wirt erworbene Gene ersetzt werden können. Dieser „horizontale Gentransfer“ ist bei vielen Holoparasiten dokumentiert und belegt, wie eng sich Wirt und Parasit im Laufe der Evolution aneinander anpassen.
„Unsere Entdeckung zeigt, dass der Verlust des Plastiden-Genoms kein einmaliges Ereignis ist, sondern sich im Verlauf der Evolution parasitischer Pflanzen mehrfach ereignet hat. Mystropetalaceae und Rafflesiaceae stellen wahrscheinlich die extremste Form pflanzlichen Parasitismus dar – sie haben nicht nur die Photosynthese aufgegeben, sondern fast alle Stoffwechselwege der Plastiden verloren und sind jetzt vollständig von ihren Wirten abhängig“, fasst Jost zusammen.
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt
Originalpublikation:
Yu, R., Jost, M., Wanke, S., Bruy, D., Li, P., Nickrent, D.L. and Zhou, R. (2025), Evidence for plastome loss in the holoparasitic Mystropetalaceae. New Phytol. https://doi.org/10.1111/nph.70709