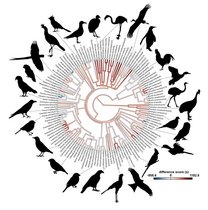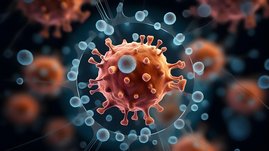Alle Fische besitzen in ihrem Innenohr winzige mineralische Gehörsteinchen, sogenannte Otolithen. "Diese Strukturen speichern das gesamte Leben eines Fisches in Form von Wachstumsringen – ähnlich wie die Jahresringe eines Baumes. Aus ihnen lassen sich Alter, Wachstumsphasen und sogar Hinweise auf Umweltbedingungen ablesen", erklärt Erstautorin Isabella Leonhard vom Institut für Paläontologie der Universität Wien.
In der modernen Meeresbiologie und Fischerei-Forschung sind Otolithen daher seit Jahrzehnten ein unverzichtbares Werkzeug, um Wachstum, Migration und Bestandsentwicklung von Fischen zu untersuchen. In der Paläontologie hingegen wurden Otolithen lange nur am Rande berücksichtigt. "Das ändert sich aber gerade, denn durch neue technische Möglichkeiten – von hochauflösender Bildgebung bis hin zu chemischen Analysen – lassen sich immer mehr Methoden, die in der Biologie seit Jahren etabliert sind, auch auf Jahrtausende bis Jahrmillionen alte Fossilien übertragen", so Leonhard. Damit rücken die Gehörsteinchen auch in der Paläontologie immer stärker ins Zentrum und eröffnen einzigartige Einblicke in frühere Fischpopulationen.
"Tagebucheinträge" von Fischen
Besonders aufschlussreich sind die mikroskopisch feinen Wachstumsringe der Gehörsteinchen, die wie die "Tagebucheinträge" eines Fisches gelesen werden können. In fossilen Otolithen waren diese Strukturen bislang oft schwer zu erkennen – einerseits, weil das Material je nach Erhaltungszustand und Ablagerungsbedingungen unterschiedlich gut konserviert ist, andererseits, weil Lichtmikroskopie und klassische Elektronenmikroskopie hier an ihre Grenzen stießen.
Das Team um die Nachwuchswissenschafterin Leonhard optimierte nun jedoch eine in der Geologie etablierte Technik für die Erforschung dieser Wachstumsringe: Mittels Backscatter Electron Imaging (BSE) werden die unterschiedlichen Rückstreuungen von Elektronen im Material genutzt, um feinste Unterschiede in der Struktur darstellen zu können. Durch gezielt optimierte Einstellungen konnten die Forschenden extrem fein gebänderte Wachstumsringe in Otolithen der Schwarzgrundel (Gobius niger) aus der nördlichen Adria, die teils seit über 7.600 Jahren im Meeresboden lagerten, sichtbar machen, die mit Standardmethoden schlicht übersehen worden wären. Insgesamt wurden so bis zu 275 Prozent mehr Wachstumsringe erkannt.
"Mit dem Elektronenmikroskop konnten wir so auch die feinsten Wachstumsringe sichtbar machen", erklärt Leonhard. Normalerweise lagern sich die feinen Ringe in einem täglichen Rhythmus ab. Zusätzlich gibt es aber auch Mikroinkremente, die unabhängig von diesem Tagesrhythmen entstehen können, etwa durch Nahrungsaufnahme, Wanderbewegungen, Veränderungen in der Umgebung oder Stressfaktoren. "Wir haben nun auch extrem feine Strukturen gefunden, die sich periodisch ablagern, jedoch in deutlich kürzeren Zeiträumen als täglich. Ihre Regelmäßigkeit deutet darauf hin, dass auch sie einem biologischen Rhythmus folgen. Was genau dahintersteckt, müsste allerdings erst geklärt werden, beispielsweise über kontrollierte Wachstums-Experimente", so die Paläontologin und Kooperations-Partnerin Emilia Jarochowska von der Utrecht Universität.
Mittels fossiler Otolithen heutige Veränderungen besser einordnen
Mithilfe der optimierten Backscatter Electron Imaging Methode können Forscher*innen künftig fossile und moderne Fischpopulationen detailliert miteinander vergleichen und damit auch heutige Veränderungen in einen größeren zeitlichen Kontext stellen. "Gerade in Zeiten von Klimawandel und Überfischung ist es wichtig, die Entwicklung von Fischbeständen über lange Zeiträume hinweg nachvollziehen zu können", betont Martin Zuschin, Leiter des Instituts für Paläontologie und ebenfalls einer der Studienautor*innen. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass fossile Otolithen ein enormes, bisher ungenutztes Potenzial bergen – und dass sie helfen können, heutige Veränderungen besser einzuordnen."
Universität Wien
Originalpublikation:
Isabella Leonhard, Emilia Jarochowska, et al (2025): Revealing growth increments in fossil and modern otoliths with backscatter electron imaging. In Limnology and Oceanogryphy: Methods. DOI: 10.1002/lom3.70006, https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lom3.70006