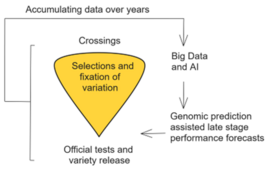Zebrafische sind ein beliebter Modellorganismus, um die neuronalen Mechanismen von Verhalten zu untersuchen – so wie zum Beispiel die des Beutefangs. Zebrafische zählen zu den echten Knochenfischen (Teleostei). Diese sind eine große und vielfältige Gruppe unter den Strahlenflossern, die über 95% aller lebenden Fischarten ausmachen und meist ähnlichen ökologischen Bedingungen ausgesetzt sind. Ob andere Arten innerhalb dieser Gruppe ähnliche Bewegungen beim Aufspüren, Verfolgen und Erlegen von Beute ausführen wie Zebrafische, oder andere Lösungen dafür entwickelt haben, ist allerdings noch nicht bekannt.
„Zebrafische eignen sich sehr gut für die Verhaltensforschung. Sie sind allerdings nur ein kleiner Punkt auf einer riesigen Evolutionskarte der Fische“, sagt Co-Autor Duncan Mearns, ehemaliger Postdoc am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. „Wir wollten wissen, ob die Strategien, die wir bei Zebrafischen beobachten, allgemeine Verhaltensmerkmale von Fischlarven sind – oder ob andere Fischarten anderes Jagdverhalten zeigen.“
Um dies zu untersuchen, verglich das Team das Jagdverhalten von Zebrafischen mit dem von fünf anderen Fischarten der Teleostei, darunter vier afrikanische Buntbarsche und der japanische Reisfisch Medaka. Alle fünf Arten haben sich vor etwa 240 Millionen Jahren von der Abstammungslinie der Zebrafische getrennt.
„Wir nutzten Hochgeschwindigkeitskameras, um in kontrollierter Umgebung Tausende von Jagdsequenzen einzelner Fischlarven mit lebender Beute aufzunehmen“, erklärt Co-Autorin Sydney Hunt, zu der Zeit Masterstudentin am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. „Danach analysierten wir die Aufnahmen mit Hilfe von Tracking-Tools, die auf Deep Learning basieren. So konnten wir die Schwanzbewegungen, die Augenposition und den Standort der Beute während jeder Phase der Verfolgung und des Beutefangs genau erfassen.“
Die Analyse zeigte unterschiedliche Strategien bei den Fischarten. Alle vier Buntbarscharten verfolgten eine binokulare Jagdstrategie ähnlich wie Zebrafische: Bevor sie zuschlagen, fokussieren sie mit beiden Augen die Beute so, dass sie sich in der Mitte des Sichtfelds befindet. Im Gegensatz dazu verlassen sich Medaka auf eine monokulare Verfolgung: Sie schwimmen durchweg und greifen von der Seite an. Dies deutet darauf hin, dass Buntbarsche und Zebrafische die sogenannte binokulare Disparität (der Unterschied der Bilder zwischen beiden Augen) nutzen, um Entfernungen einzuschätzen. Medaka hingegen verwenden möglicherweise die Bewegungsparallaxe: Dabei basiert die Tiefenwahrnehmung auf der Position der Beute relativ zum Jäger, während sich diese durch den Raum bewegt.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellten auch deutliche Unterschiede im Schwimmverhalten der Larven während der Jagd fest. Während Buntbarsche immer wieder Pausen machen (was wahrscheinlich ihre binokulare Tiefenwahrnehmung verbessert), gleiten Medaka in einer fließenden Bewegung an ihrer Beute vorbei. Bei der Analyse der Schwanzbewegungen der Fischlarven zeigte sich, dass Buntbarsche beim Schwimmen ein vielfältigeres Repertoire an Verhaltensweisens einsetzen als Zebrafische. Dazu gehört zum Beispiel das Einrollen des Schwanzes, das Schweben und das Rückwärtsschwimmen nach einem erfolglosen Angriff.
Bei den Buntbarschen wurden zudem zwei Haupttypen von Angriffen beobachtet: das „Angriffsschwimmen“ mit symmetrischen Schwanzbewegungen und der explosivere „Fangsprung“. Medaka hingegen setzen einen einzigen „Seitenschwung”-Angriff ein. Selbst unter den eng verwandten Buntbarscharten unterscheiden sich Anzahl und Vielfalt der Verhaltensweisen erheblich, was auf eine artspezifische Spezialisierung bezüglich der Motorik hindeutet.
„Unsere Ergebnisse stellen die Annahme infrage, dass das Verhalten von Zebrafischen ein allgemeingültiges Modell für Fischlarven ist“, sagt Herwig Baier, Letztautor der Studie und Direktor am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. „Verschiedene Arten nutzen unterschiedliche Sinneseindrücke und Bewegungsstrategien – und das sogar schon in den frühen Entwicklungsstadien. Wenn wir diese Unterschiede verstehen, können wir besser nachvollziehen, wie neuronale Verschaltungen das Verhalten beeinflussen und wie die Evolution diese Netzwerke in verschiedenen Abstammungslinien formt.“
Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz
Originalpublikation:
Duncan S Mearns, Sydney A Hunt, Martin W Schneider, Ash V Parker, Manuel Stemmer, Herwig Baier: Diverse prey capture strategies in teleost larvae, eLife13:RP98347. doi.org/10.7554/eLife.98347.3